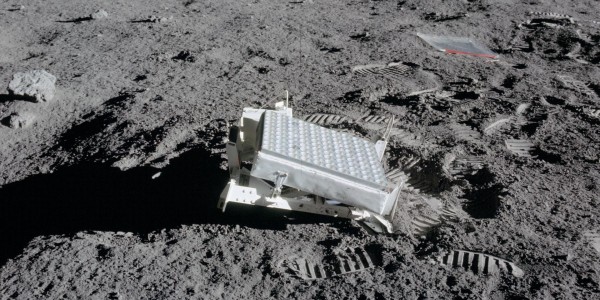Dr. Ewald, US-Präsident John F. Kennedy sagte zu Beginn des Apollo-Programms in einer historischen Rede: „Wir haben uns den Mond ausgesucht, nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwer ist.“ Das klang nach Herausforderung, nach Abenteuer. Hat er damit auch den Nerv der Astronauten getroffen?
Astronauten sind zunächst einmal keine Abenteurer. Sie suchen nicht das Risiko, zumindest ist das meine eigene Erfahrung. Als ich mich für den Astronautenberuf beworben habe, war mein Flug noch weit weg. Da war der Weg dorthin spannend: das Training, die Experimente, aber auch der Spaß an der Herausforderung, das stimmt. All das hat mich während meiner Trainingszeit motiviert.
Und als es schließlich losging? Wurde Ihnen dann die Monstrosität des Vorhabens bewusst?
Wenn man vor der Rakete steht und dieses fauchende Ungetüm sieht – selbst die Sojus ist ja 55 Meter hoch –, ist das schon beeindruckend. Aber da geht man nicht mehr zurück. Da ist man neugierig darauf, was im Weltall alles auf einen wartet.
Kennedy hat seine Rede damals an der Rice University allerdings nicht für Astronauten gehalten. Er wollte die breite Masse begeistern. Was macht die Rede aus heutiger Sicht so interessant?
Dass da jemand eine Vision voranbrachte, auch wenn er diese Idee sicherlich nicht aus Interesse an der Erforschung des Mondgesteins entwickelt hatte. Doch Kennedy sah – vielleicht durch seine Berater, vielleicht durch seine eigene Intuition – das Apollo-Projekt als eine Möglichkeit, die Nation zu einen und hinter einem lohnenden Ziel zu versammeln.
Und eine große Vision braucht eine große Rede?
Das ist so bei Visionen. Bei der Frage, ob man Menschen hinter einer Vision versammeln kann, entscheidet nicht nur die Größe des Wurfs, sondern auch dessen Präsentation – aber auch die Fähigkeit, das Vorhaben umzusetzen. Als amerikanischer Präsident hatte Kennedy die Größe, ein neues Kapitel aufzuschlagen und die USA zur Weltraumnation zu machen. Und er hatte, zumindest in den Anfangsjahren, auch die Möglichkeit, so etwas finanziell durchzusetzen.
Ist Kennedys Rede für Sie heute noch von Bedeutung?
Ja, ich erwähne die Rede beispielsweise in meinen Vorlesungen – als Lehrstück, wie wichtig bei solchen Projekten die passende Wortwahl, der passende Zeitpunkt und das passende Charisma sind. Und als Beispiel dafür, dass solch ein rhetorisches Ausrufezeichen durch die Kleinmütigkeit nachfolgender Administrationen nicht mehr wegdiskutiert werden kann. Die direkt Kennedy folgenden Präsidenten sind ja alle eingestiegen, sonst wäre Apollo nicht zustande gekommen.
Fehlen in der heutigen Raumfahrt entsprechende Visionen und Visionäre – insbesondere in Europa?
In Europa sind wir zwar sehr gut aufgestellt bei Navigations- oder Erdbeobachtungssatelliten und haben mit der Ariane die nötige Rakete für deren Starts. Beim bemannten Raumflug müssen wir aber immer mit internationalen Partnern kooperieren. Würde Europa in diesem Bereich eine eigene Vision verkünden, wäre das ein bisschen unglaubwürdig – sofern nicht auch ausreichend eigene Mittel bereitgestellt würden.